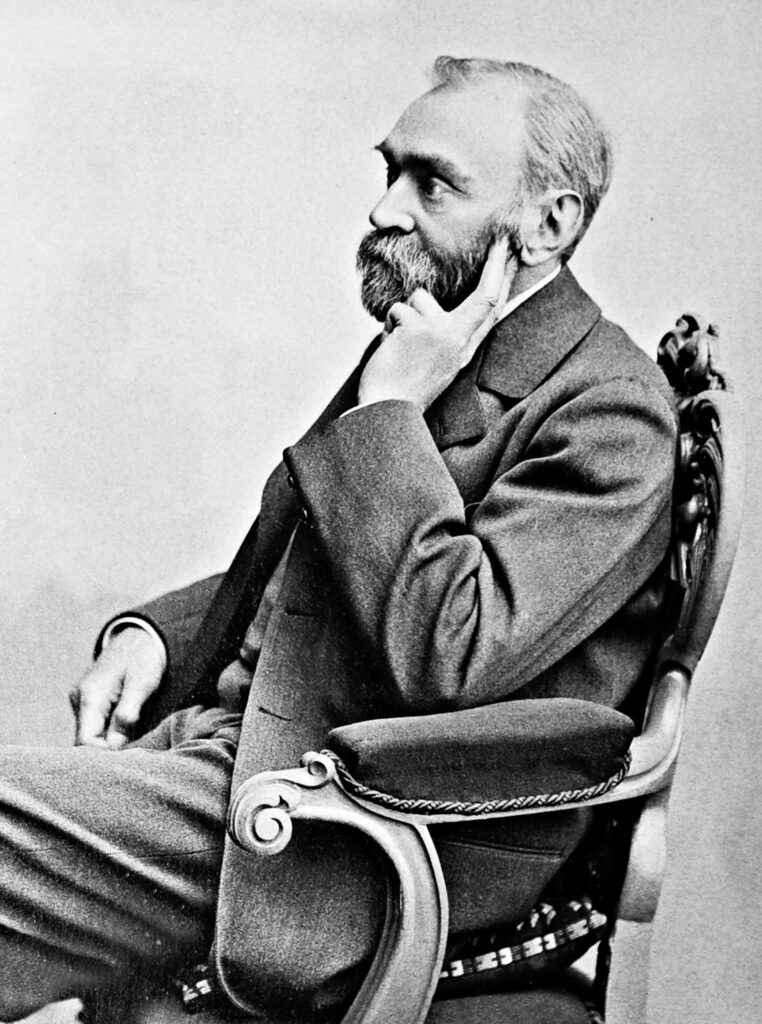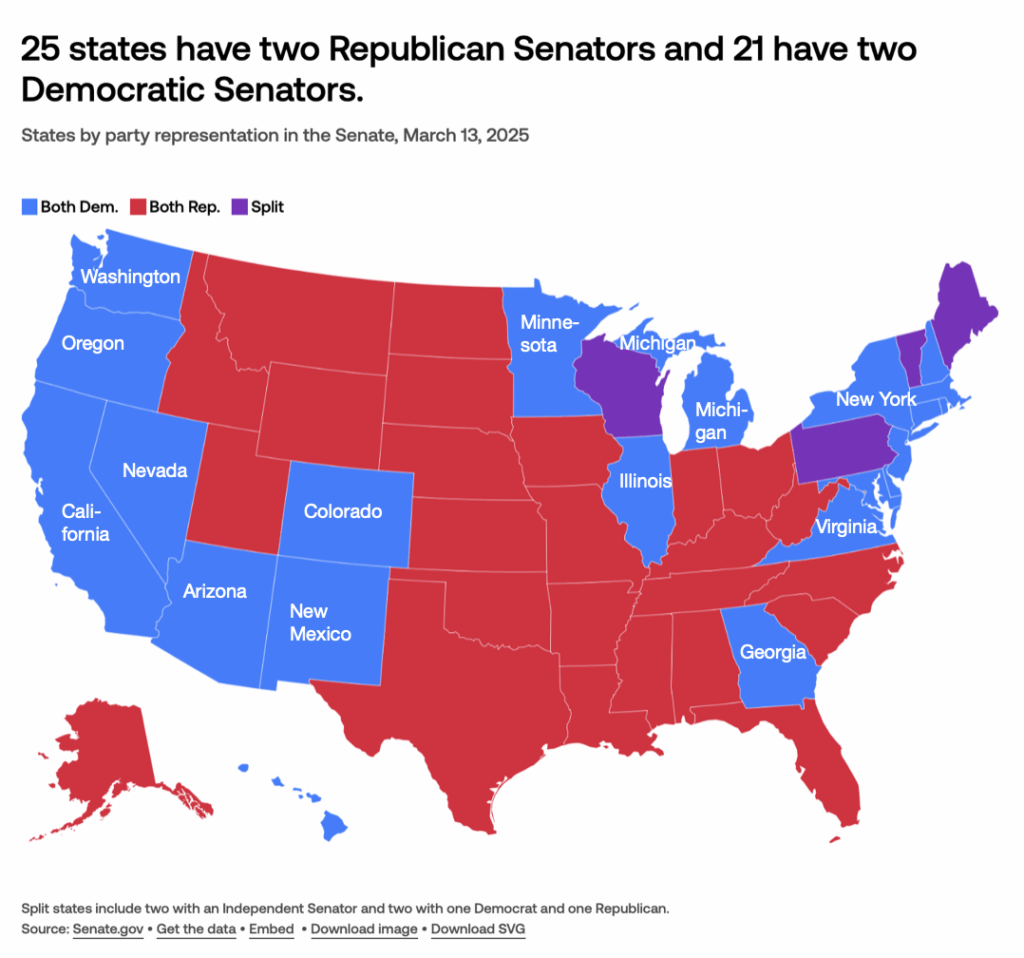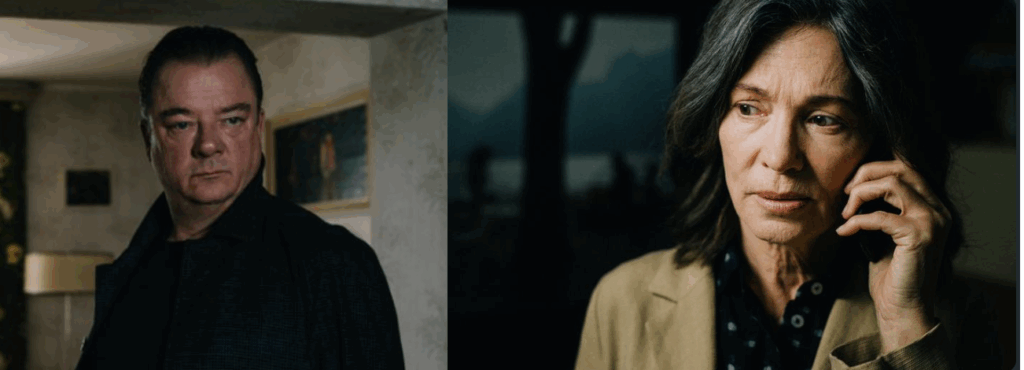(Frankfurter Latern 1860 / Wikimedia Commons)
Im demokratischen Athen der Antike wurden alle öffentlichen Ämter durch das Los bestimmt: Bürgerrat, Regierung und Richter – nur die Armee wurde ausgelost.
In der deutschen Demokratie soll es künftig genau umgekehrt gehen: Die ewig gleichen Gesichter im Parlament, in der Regierung und auf den Richterstühlen – aber künftig soll ausgelost werden, wer zur Bundeswehr muss. [1]
Das wirft nicht nur ein grelles Licht auf die Unlust der Jugend, sich zum Wehrdienst zu melden, der politisch zum Krieg gegen Russland missbraucht zu werden droht – es macht auch deutlich, zu was die Demokratie in Deutschland und in Europa verkommen ist.
Anders, aber nicht wirklich besser im Land der hochgelobten direkten Demokratie: Eine Schweizer Volksinitiative will die Wehrpflicht für Männer durch einen obligatorischen Einsatz junger Männer und Frauen für Gemeinschaft und Sicherheit ersetzen. Jede Person soll sich dort einsetzen, wo sie gebraucht wird und etwas beitragen kann, in der Armee, im Zivilschutz, im Umwelt- und Katastrophenschutz, im Gesundheitswesen, in der Bildung oder in der sozialen Betreuung. Bürgerliche und rechte Parteien und Wirtschaftsverbände führen eine Gegenkampagne und warnen vor «negativen Folgen für Wirtschaft, Armee und Milizsystem». [2]
Auch in der Schweiz fürchten rechte Kreise, der Armee könnten die Soldaten ausgehen. Dann hört doch endlich auf, Krieg zu spielen!
Quellen:
[1] https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/wehrpflicht-lotterie-bundeswehr-einigung-union-spd-bundestag
[2] https://www.srf.ch/news/schweiz/service-citoyen-deshalb-lehnt-das-gegenkomitee-die-initiative-ab